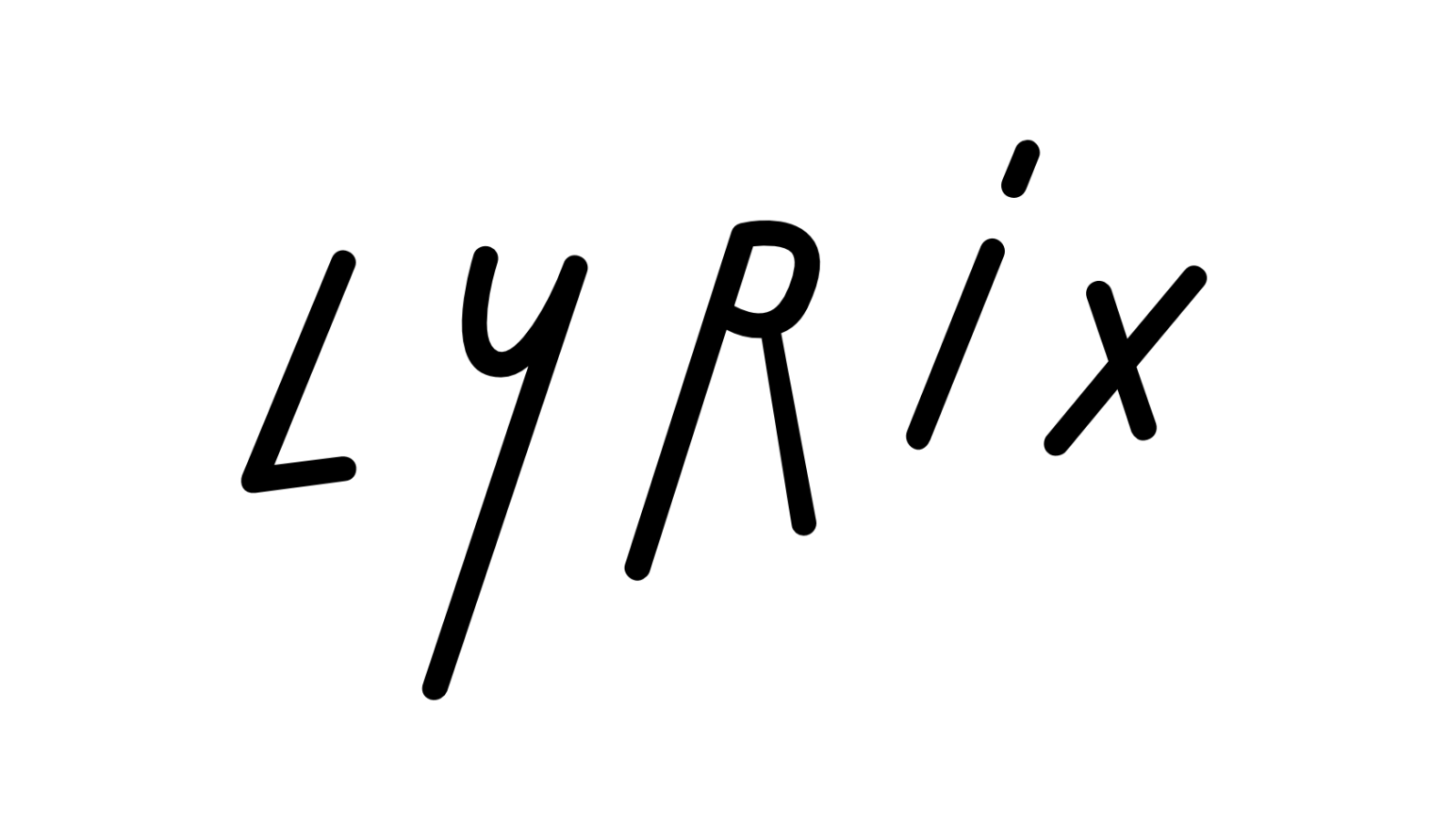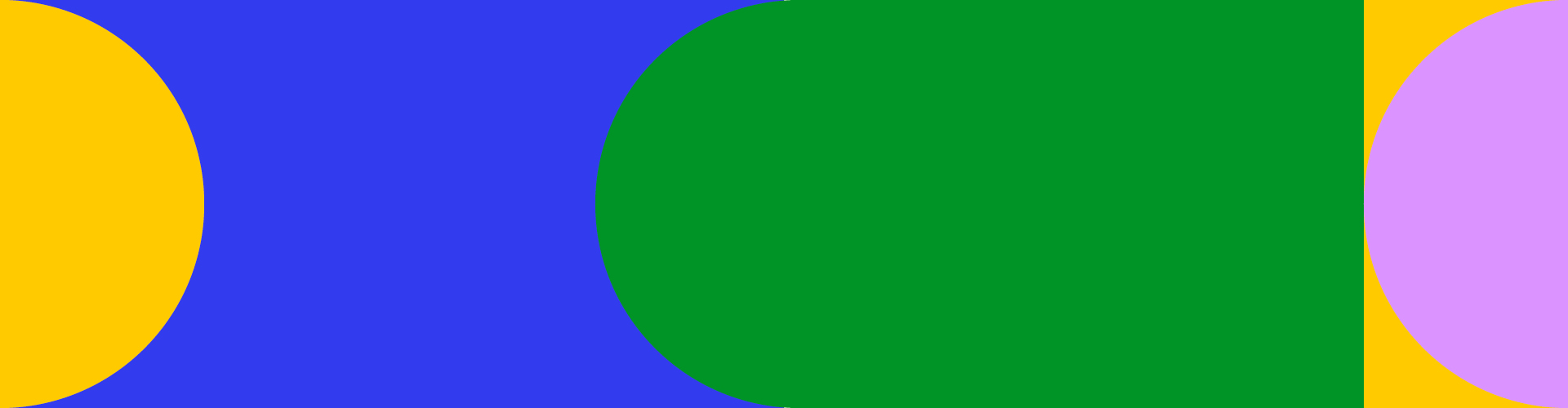Unsere Gewinner*innen im August 2019
„ich gehe durch meine stadt und es ist nicht meine stadt durch die ich gehe“ – so heißt es in der Zeile aus Arne Rautenbergs Gedicht „die vogeluhr. Sonnenaufgang 4.30 uhr. mitte mai.“ Auch in euren Texten verweben sich innere Stimmen und persönliche Ansichten mit der Umgebung, dem Ort, der Stadt.
Es tauchen Zeichen der Zerstörung, Verwirrung, Beengtheit auf: „Irgendwo zischen Zwiebeln in Pfannen Todesschreie.“ Irgendwo anders sucht das Heute „füße auf den särgen der träume der menschen, die hier lebten“ oder „das Hochgepriesene gemein verkafft“ Es gibt aber auch Bilder der Verbundenheit, Worte und Sätze des Ineinanders von erzählendem Ich und dem Ort, an dem es lebt oder an den es denkt: “Jede Sekunde geht Damaskus durch mich / Keine Sekunde kann ich durch sie gehen“. Wir lesen von Seelenlandschaften genauso wie von konkreten Stadtbildern und wie sich alles umeinander neu sortiert, Brüche bleiben unvermeidbar.
Lasst uns lernen, im Tee zu schwimmen
In den Rissen gelber Steine verstecken sich Echsen und fauchen.
Ihre Schreie werden vom Wind davongetragen und verlaufen sich dann auf dem Wellengang.
Die destillierte Stille über der lilanen Stadt
Ist angefüllt vom Brummen und Rufen des Marktes, vom Surren der Mücken, von geflüsterten Geheimnissen unter Bettdecken, von schimpfenden Mütterstimmen, vom Klirren der Schnapsgläser alter Männer.
Irgendwo zischen Zwiebeln in Pfannen Todesschreie.
Die Dächer der Stadt spielen Murmeln mit den Wolken.
Die Menschen ganz oben haben noch nie den Regen gesehen und schütteln ihre Köpfe über Noah
und seine Geschichten.
Alle paar Tage verläuft sich eine Seele ans Meer und zieht mit den Zehen Bahnen in die Schlieren des Wassers.
Manche von ihnen wünschen sich ein bisschen, mit Schaum gekrönt zu werden. Dabei merken sie nicht, dass ihr Herz in ihnen pocht
pocht
pocht so laut, dass die Leute, die über die Promenade flanieren, sich die Ohren zuhalten.
Auf den Einkaufsstraßen stöckeln viele rote Schuhe mit langen Beinen daran.
Vor der Leere davon.
An den Straßenecken stehen Händler und bieten das Glück feil.
In den Höfen hinter hohen Mauern spielen Kinder mit Mülldeckeln und trinken kalte Limonade zu schnell.
Das Stück Himmel, das man von hier aus sehen kann, ist stählernstrahlendblau.
Wenn die Sonne hier untergeht, wird ihr Licht nicht durch das von Sternen ersetzt, sondern es ist die Stadt selbst, die anfängt zu glitzern. Sie pulsiert in scheppernden Rhythmen.
Meine Oma trinkt ihren Tee mit Zucker und Zitrone.
Manchmal singt sie Lieder aus der Zeit, in der die Menschen noch eine Stimme hatten.
windschief
der himmel stand ungewöhnlich hoch an diesem morgen
was glaube ich dazu beitrug
dass sie einfach aus ihren fugen glitt
ich hatte schon viermal alle meine möbel verrückt
das bett zum fenster geschoben es wieder weggestellt
weil ich befürchtete es würde nachts ebenso einfach hinauskippen
ich war in die hocke gegangen
aufs hausdach geklettert
hatte erst lange und intensiv
dann mehrmals schnell und flüchtig
wie versehentlich
immer wieder hingeschaut
aber es half nichts
jemand hatte die maßstäbe verändern lassen
alles gleichmäßig wachsen oder schrumpfen lassen
und mich vergessen
hatte es schief zurückgehängt
und jetzt spürte ich wie es langsam
vom dünnen nagel rutschte
ich kramte nach alten fotos
hielt sie zum vergleich daneben
suchte nach fehlern aber fand nichts
konnte nicht einfangen was sich anders anfühlte
das licht das nicht mehr jede linie
stechend scharf hervorhob
sondern nurmehr vorsichtig streifte
die farben die über den dingen lagen
wie ein schmieriger film
den ich abzog
und in meiner hosentasche zerknüllte
meine stimme humpelte
hallte komisch nach wenn sie von den hausfassaden
abprallte
mein atem schlägt kreisrunde weiße purzelbäume
ich hielt mir die hände vor den mund
im treppenhaus stolperte ich über
die sechszehnte der fünfzehn stufen
bemerkte zum ersten mal
die wie farnwedel eingerollten klebereste an den wänden
die aprikosenkerne die sich in den ecken stapelten
mir fiel auf dass wir das letzten monat schon
mir fielen noch mehr dinge auf –
draußen regnete es
ich konnte mich an keinen einzigen tag erinnern
an dem es je geregnet hatte
es klang wie klitzekleine kieselsteine
die jemand gegens fenster warf
unter mir lief unbekümmert das wasser
in kleinen rinnsalen zusammen
ich atme tief ein
versuche nach vertrautem zu tasten
jede stadt hat ihren eigenen geruch
lasse ich es denken
übernehme den gedanken
diese hier roch nach zypressen und verbrannter luft
und sie war viel zu heiß
alle vögel sind schon weg
seit der metallische regen über die stadt hereinbrach
und für jahre dort wütete,
war ich nicht mehr an diesem ort
jetzt bin ich wieder hier
und fahre mit meinem blick die wunden nach, die die tropfen hinterlassen haben
ich fange an, die ersten zu desinfizieren, doch gebe schon bald auf
die stille hat sich in der stadt niedergelassen
eine unerbittliche regentin, die jedes geräusch unterdrückt, das versucht, sie zu stürzen
ich singe, halb aus neugier, halb aus trotz:
alle vögel sind schon weg
alle vögel
alle
(altes kinderlied, das mich das defätistischsein schon früh lehrte)
und bekomme ihre macht in voller größe zu spüren
_ _
der wind streicht um die ruinen
ratlos
rastlos
lautlos
haucht er seinen atem in sämtliche ritzen und rillen
bei dem versuch, die mauern wieder zu beleben
ich hoffe nur, er ist ausdauernd genug
dafür
mein blick schneidet sich an zerklüfteten mauerfragmenten,
aus meinen augen tritt durchsichtiges blut
mir fällt ein: ich bin nicht gegen tetanus geimpft
(ich reibe mir wie wild die augen, um potentielle melancholisch verunreinigte bakterien zu
entfernen)
die seele (m)einer stadt liegt vergraben unter einer schicht aus schutt und staub
tag für tag befreit sie der wind ein bisschen mehr,
doch bis dahin
(vielleicht helfe ich ihm und grabe singend in der fremde, bis sie mir wieder vertraut erscheint)
Damaskus, meine Blume
Ich sehe sie
Die rote Stadt
Ich rieche sie
Die duftende Stadt
Ich höre sie
Die geräuschvolle Stadt
Sie schreit nach mir
Jede Sekunde geht Damaskus durch mich
Keine Sekunde kann ich durch sie gehen
Ich fühle sie
Die niedergeschlagene Stadt
Ich küsse sie
Die armselige Stadt
Ich umarme sie
Die rettungslose Stadt
Sie klagt mir ihr Leid
Jede Sekunde geht Damaskus durch mich
Keine Sekunde kann ich durch sie gehen
Ich spüre
Ihre Aussichtslosigkeit
Die Zerstörung
Den Zusammenbruch
Die Heimatlosigkeit
Den Verlust ihrer Söhne und Töchter
Sie flüstert in mein Ohr
Weine nicht, mein Kind
Irgendwann spürst du meinen Boden, so wie ich dich spüre
Irgendwann erwidere ich deine Küsse und Umarmungen
Irgendwann stillen wir gegenseitig unseren Durst
Doch ich weine nicht, weil sie durstig ist
Denn das Blut durchfließt sie in Strömen
So viele Leben hat sie aufgesogen
Ich weine, weil Damaskus eine Blume ist
Und als Blume verdient sie Wasser
Ich weine nicht, weil sie hungrig ist
Ihre Straßen sind voll von Leichen
Ich weine, weil Damaskus eine Mutter ist
Die ihren eigenen Hunger stillen muss
Nach der Nähe ihrer Kinder
Einen wichtigen Teil von mir verdient sie
Und das ist mein Herz
Durch Berlin gehe ich jede Sekunde
Berlin geht keine Sekunde durch mich
Dort wo dich die Kreissäge weckt
hängen die Straßenschilder höher
als die Giebel der Einbahngassen
ihre Kanten des Vorstellbaren
fest unterm Dachboden verschnürt
wo Toleranzgrenze und Frustrationsschwelle
das Grundstück bilden und näher beieinander liegen
als so manche Eheleute, nur drüber geredet wird nicht
mehr Gerüchte machen die Runde als Einsame mit Hunden
hier wird sich noch nicht mals
ein Dialekt geleistet Mundart verwahrlost
entsteht da wo nicht Heimat sein soll
immerhin wird reingeboren und rausgestorben
wo du niemals eine Gegenfrage erwarten solltest
wenn der Pöbel wieder verdutzt gafft sobald der Bolzplatz
geschlossen bleibt wie die Gesellschaft Leiden
schafft das Hochgepriesene gemein verkafft
und als Nachtmensch wird man hier doppelt bestraft
wenn dich morgens die Sägelaute aufrütteln
und Nachbarn das Ende des Friedens
das Ende der Nacht anbahnen
ein vergangener Ort. ein Haus mit Garten
und doch alles außer Heimat.
keiner geblieben, keiner geblieben wie er war
steine unter nackten füßen
unter schweren gedanken
neben den häuserfassaden,
an denen schatten vergangener tage
im vorrübergehen hängen geblieben sind
plastiktüten, haben sich über die plätze gelegt, an denen kinderhände
den vergessenen staub
aus fugen kratzten
leben, war wohl ertrunken in gesprächsfetzen
geschwängertem fußgetrappel
längst verklungen zwischen
kaugummiflecken auf den unbekannten doch vertrauten straßen
einsamkeit, zwischen menschen, in masse versunken
wenn die vergangenheit geht und die zukunft bleibt
und das heute sucht
füße auf den särgen der träume der menschen, die hier lebten
die nur noch
– vergessene erinnerungen –
sich langziehen, wie die kaugummis, fäden
zwischen fußsohlen und bodenplatten
fremd geworden, sich verlebt, fortgelebt haben
durch straßen in denen geburt
in denen leben
in denen nicht mehr zuhause ist
fragmente einst bekannter orte durchschreitend
keiner geblieben, keiner geblieben wie er war
nur alleine auf dem platz in der mitte der Stadt
nackte füße auf steinen
die letzten gedanken aufsaugend
dann gehen.
und sich fragen was bleibt.
Wir danken euch für eure Texte und gratulieren den sechs Gewinner*innen: Selin Eslek, Vivian Knopf, Laura Meroth, Rojin Namer, Tom Niklas Pohlmann und Pauline Weigel!